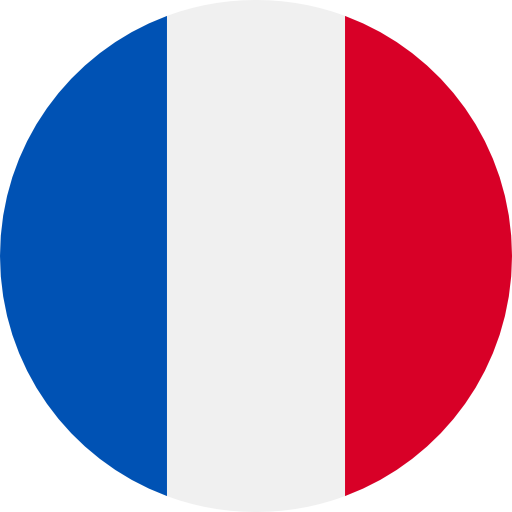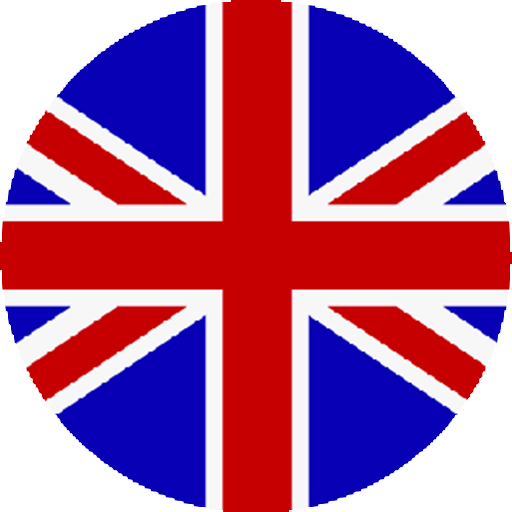FERENBALM
1. Stock Nr. 121, 17 Jh.
2. Pfarrhaus, erb. 1746
BIBEREN
3. Stöckli/Bauernhaus Nr. 99a/b, dat. 1793, sign. M S R (?)
4. Bauernhaus Nr. 93, 17./19. Jh.
5. a) Stöckli Nr. 90a, dat. 1817
5. b) Bauernhaus Nr. 90, dat. 1770, sign. M P M
5. c) Ofenhaus/Speicher, Nr. 90b, Anfang 19. Jh.
ULMIZ
6. Bauernhaus Nr.: 44, dat. 1768, sign. M P M
7. Ofenhaus Nr. 4, 18. Jh. (?)
8. Wirtshaus «zum Jäger» Nr. 22, 1863
9. Bauernhaus Nr. 14, dat. 1781, sign. M J D
WALLENBUCH
10. Kapelle Nr. 25, um 1800
11. Bauernhaus Nr. 19, 18. Jh./1822
12. Speicher Nr. 20, dat. 1709
VOGELBUECH
13. Bauernhaus Nr. 103, dat. 1747, sign. M A S T
Wanderzeit 2-3 Stunden
FERENBALM
Ferenbalm, ursprünglich «Balm das ferr» also das von Bern aus fernere Balm (im Gegensatz zu Oberbalm bei Köniz) hat seinen Namen von der Sandsteinfluh, auf der die Kirche steht. Zu Füssen dieses Felsens, in der eigentlichen «Balm» (=höhlenartiger Überhang») befand sich die Wallfahrtskapelle der heiligen Radegundis, die bis zur Reformation fleissig aufgesucht wurde. Nach dem Glaubenswechsel hiess es, alle Spuren des «Papsttums» zu tilgen, was nicht überall eitle Freude auslöste. Die Ferenbalmer mussten jedenfalls mehrmals ermahnt werden, die Kapelle nun endlich dem Erdboden gleichzumachen (und damit alle Hoffnung auf die Weiterführung des einträglichen Wallfahrtsgeschäfts fahrenzulassen).
Die Kirche, ein einfacher Bau, beherrscht mit ihrem, für die bernische Landschaft typischen Turmhelm einen besonders anmutigen Abschnitt des Biberentälchens.
Neben der Kirche das Alte Schulhaus von 1826/1877. Es handelt sich hier bereits um die dritte Generation des Pfarreischulhauses (Vorgängerbauten 1667 und 1753), in das ursprünglich die Kinder von sechs Gemeinden zur Schule gingen. Das Ferenbalmer Wappen zeigt Schlüssel und Schwert als Embleme der Kirchenpatrone Peter und Paul über der Laupen-Linde.
1. Stock Ferenbalm 38, 17. Jh.
Turmartiger Wohnbau als Variante des spätgotischen Stocks vgl. Nr. 1 A, Objekt 3, Route Nord). Die Restaurierung 1983/84 hat dem Objekt sein ursprüngliches Aussehen zurückgegeben (gekehlte, gotische Fenstergewände, Holzlaube).
2. Der Pfarrhof
Der Pfarrhof schmiegt sich an die erwähnte Fluh unterhalb der Kirche und besteht aus Pfarrhaus, Ofenhaus, Unterweisungslokal, ehemals auch aus der Pfrundscheune. Die Einkünfte des Pfarrers stammten ja in alter Zeit zu einem grossen Teil aus dem meist von einem Pächter bewirtschafteten Pfrundgut, zu dem z. B. auch Rebland gehörte (vgl. Flurname «Rebli» südlich des Pfarrhauses). Das Pfarrhaus in seiner heutigen Erscheinung stammt aus dem Jahr 1746. Der Voranschlag für den damaligen Neubau vermerkt, das ein kürzlich erstellter gewölbter Keller erhalten bleiben, das neue Haus also auf dem alten Grundriss errichtet werden solle. Es werde danach drei Etagen umfassen, die Küche im Erdgeschoss, mit insgesamt 29 «Liechtpfenstern». Für die damalige Sparsamkeit der bernischen Regierung sprechen diverse Anweisungen zur Wiederverwertung alter Bauteile im neuen Haus, so z.B. der Öfen. Wegen des starken Bergdrucks mussten an den Hausecken Strebemauern errichtet werden.
Der hohen Stellung des Pfarrberufs gemäss- es durften im Ancien Régime nur Patriziersöhne Theologie studieren- hat das alte bernische Pfarrhaus einen herrschaftlichen Anstrich (geknicktes Vollwalmdach, symmetrische Fassade ). Es war mit der Kirche und dem patrizischen Landsitz zusammen fast das einzige, ganz in Stein errichtete Gebäude in den Dörfern des bäuerlichen Mittellands.
Der Bibere entlang, die dem Dprf seinen Namen gegeben und hier eine Säge (unterhalb des Hotels Biberenbad), Öle und Mühle betrieben hat, erreichen wir das
BIBEREN
3. Bauernhaus mit Stöckli, Schmidmattweg 15, dat. 1793/1870
Eine originelle Verbindung von Haupthausund Stöckli: Letzteres, dat. 1858 hat gleichsam Tuchfühlung behalten und ermöglicht den Rückzug der Stöcklibewohner trockenen Fusses. Elegantes Mansart-(«französisches») Dach mit geschweifter Ründi. Am Haupthaus gemalte Tennstorinschrift Jacob Stöckli und Anna Arn), bemalte und geschnitzte, geschenkte Büge vgl. Objekt 1, Route Nord). Renovation 2023
4. Bauernhaus Bodengässli 2, 17 Jh.
Riegbau mit Teilwalmdach, Gehrschild und Ründi. Das Riegwerk wurde bei der letzten Renovation wieder sichtbar gemacht. Am Keller-Unterbau Verwendung von gelbem Jurakalk, aus dem auch die ausgetretenen Treppenstufen bestehen. Ein Bauernhaus mit herrschaftlichem Anstrich, das wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem alten Mühlegut steht. Teile des Baus könnten auch auf eine Dépendance des ursprünglichen Wirtshauses zurückgehen, das sich neben der Mühle befand. Die Biberenmühle gehörte vor 200 Jahren der Berner Schultheissenwitwe von Fischer. Am Ende des Mittelalters gab es zeitweise auch Murtner und Freiburger Besitzer, was die Rivalität der drei nächstgelegenen Städte an diesem verkehrstechnisch wichtigen Ort veranschaulicht.
Schräg gegenüber ein 1869 datiertes Bauernhaus in Riegwerk. In Richtung Mühle Blick auf ein typisches Heimatstil-Bauernhaus der Zwischenkriegszeit (1922).
Beim Anstieg auf dem Weg nach Ulmiz kommt ein Anwesen ins Blickfeld, das seine Nebenbauten, Stöckli und Speicher/Ofenhaus in auffälliger Distanz zum Bauernhaus hält.
5. a) Stöckli Nr. 90a, dat. 1817
Das Stöckli zeigt eine symmetrische Fassade mit Stichbogenfenstern und Masartdach. Die Häufigkeit der Stöckli in dieser Gegend ist zweifellos ein Zeichen ehemaligen bäuerlichen Wohlstandes.
5. b) Bauernhaus, Wannerenweg 8, dat. 1770
Das Bauernhaus tammt vom bekannten Agriswiler Zimmermeister Peter Mäder. Teilwalmdach mit Ründi. Es wurde angeblich von Buech/Mühleberg versetzt.
5. c) Speicher/Ofenhaus, Wannerenweg 8a, Anfang 19. Jh.
Der Mauerteil (ehemaliger Backraum) wurde zu einer Werkstatt umfunktioniert. Das Obergeschoss in Ständerbau ist als Kornspeicher erkenntlich durch die Doppelschwelle mit Zwischenraum, die den freien Luftzug zum Trockenhalten des Getreides gewährleistete.
ULMIZ
Ulmiz, frz. Ormey, das sich in der Talsenke zwischen Bibere und dem Galmwald ausbreitet, soll seinen Namen von den früher auch hier noch häufig anzutreffenden Ulmen haben. Die freiburgische Gemeinde gehört (wie Agriswil, Büchslen, Gempenach und ein Teil von Ried) zur reformierten Kirchgemeinde Ferenbalm. Allerdings war das Dorf schon am Ende des 17. Jh. wohlhabend und selbstsicher genug, um sich eine eigene Schule zu leisten. Sie kam damit der bernischen Schulordnung von 1720 zuvor, wonach die Gemeinden danach trachten sollten, eigene Schulhäuser zu bauen und diese womöglich in der Mitte des Dorfes zu platzieren.
Im Gegensatz zur Radegundis-Kapelle in Ferenbalm, die als katholische Wallfahrtsstätte den neugläubigen Oberen in Bern sehr bald ein Dorn im Auge war, hat die hiesige, dem heiligen Johannes geweihte Kapelle viel länger überlebt und sogar das Schulhaus-Glöcklein geliefert.
6. Bauernhaus Friedhofweg, dat. 1768
Der eindrückliche seltene integrale Holzbau richtet seine Fenster, doppelt geschützt vom grossen Querschild und den beiden Lauben, nach Süden. Auch er ist ein Werk des Agriswiler Zimmermeisters Peter Mäder. Zuversichtlich meldet die Inschrift über den Stubenfenstern:
GOTT DER HERR WIRD ALLE WÄRCK FÜR GERICHT BRINGEN WAS VERBORGEN IST ES SEI GVT ODER BÖS
Wir überqueren die Bibere und streben dem Dorfkern zu, der mit seinen frisch restaurierten Riegbauten zu den einladendsten Ortsbildern des Seebezirks gehört. Links an der Strasse, vor dem alten Mühlequartier, steht das Gemeinde-Ofenhaus.
7. Gemeinde-Ofenhaus Unterdorfstrasse 4, 18.Jh.
Einfacher Zweckbau vgl. Ried Nr. 2, siehe Objekt 9, Route Nord
8. Wirtshaus «zum Jäger» Dorfstrasse 104, dat. 1863
An zentraler Stelle, bei der Verzweigung der Strasse nach Freiburg und Kerzers. Über gemauertem Erdgeschoss 1. Stock in Fachwerk. Mansart- oder nach dem regionalen Sprachgebrauch «französisches» Dach, das zweifellos von der Architektur der Herrensitze inspiriert ist und dem Bau eine vornehme Note gibt.
Dieselbe Wandkonstruktion (Erdgeschoss gemauert, Obergeschoss Fachwerk) zeigt das nördlich auf der gleichen Strassenseite anschliessende Bauernhaus mit hochgezogener Ründi (Ende 19. Jh.).
9. Bauernhaus Dorfstrasse 99, dat. 1781
Fachwerkbau mit imposantem Teil-Walmdach. Der Querschild ist erst im 20. Jahrhundert zurückgestutzt worden, um etwas mehr Licht zu gewinnen. Der Bau nimmt im Ortsbild (Blick auf die Strassenkreuzung!) eine bedeutende Stellung ein.
Wie die Tennstor-Inschrift (in kunstvoller Fraktur) meldet, wurde das Haus von Zimmermeister Jacob Diesch von Ried erstellt, dessen Vorfahren von Chaindon/Reconvilier im Amt Moutier zugewandert waren. Ihre Assimilation an die neue Heimat machte anscheinend weder beim Namen (Diesch aus ursprünglich Tièche) noch bei der Bauweise halt: Auch der fremde Hintersäss baut ganz in der lokalen Tradition und unterzieht sich dem Brauch der geschenkten Büge, die rundum, mit verschiedenen Initialen und Profilen versehen, das Vordach stützen. Renovation und Umbau 2016
Von der Dorfkreuzung aus, die ein stattlicher doppelter Brunnen aus Jurakalk ziert, sind in Richtung Süden ein weiteres Bauernhaus und ein Stöckli sichtbar. Dem Wirtshaus gegenüber steht die alte Käserei (Ende 19.Jh.)
Wir kehren um und überqueren ein zweites Mal die Biberenbrücke, diesmal aber in Richtung Rizenbach. Nachdem wir die letzten Häuser von Ulmiz hinter uns gelassen haben, ist ein weiterer Grenzübertritt zwischen Freiburg und Bern fällig. Wir absolvieren diesen zum Glück ohne Formalitäten, dafür mit einem Blick auf die Grenzsteine aus Jurakalk an der Strasse. Rund 500 Jahre schon markieren diese eine doch eher fiktive Scheidelinie, die mehr Verbindendes als Trennendes beinhaltet.
Nur einige Schritte weiter, und wir stossen in dieser anscheinend von Interessengegensätzen durchzogenen Gegend bereits auf eine neue Grenze, die nun diesen Namen eher verdient. Zuvor aber rufen wir uns angesichts des Ausssiedlungshofes in der Steineren, die in den 1970er Jahren abgeschlossene Güterzusammenlegung Ferenbalm-Wallenbuch, in Erinnerung, die nicht zuletzt wegen des Autobahnbaus der N1 notwendig wurde. Wir durchqueren danach den Dählenwald, von dem es heisst, er sei einst den ehemaligen Besitzern von Biberen von den Schlaueren Ulmizern um ein «Zimmis» (=Zwischenimbiss) abgeluchst worden. Dieses freundnachbarliche Misstrauen gedeiht aber nicht nur in unserer Gegend, hat es doch gerade in dieser anschaulichen Redensart eine weite Verbreitung gefunden.
WALLENBUCH
Die freiburgische Enklave Wallenbuch bildete bis zur Reformation einen Bestandteil der Pfarrei Ferenbalm. Kurz zuvor hatte die Stadt Freiburg, die in ihrem Expansionsstreben im Raum zwischen Saane und Murtensee auf die bernische Konkurrenz stiess, die Herrschaftsrechte über das Dorf erworben und sorgte nun dafür, dass Wallenbuch katholisch blieb und damit auch politisch von seinen Nachbarn getrennt wurde. Das mehr als 400jährige Sonderdasein wirkt sich trotz der heute ungetrübten Beziehungen zur andersgläubigen Umwelt noch in manchem aus: So spricht die Bevölkerung im Gegensatz zum auch im protestantischen Murtenbiet vorherrschenden Berndeutsch einen senslerisch gefärbten Dialekt.
10. Kapelle 1599/1810
Die der heiligen Barbara geweihte einfache Dorfkapelle im Zentrum der Siedlung ist mindestens schon der dritte Bau an dieser Stelle. Nach der ersten Erwähnung im Jahre 1474 erfolgte 1599 ein Neubau, nachdem festgestellt worden war, dass die Kapelle zu Wallenbuch sonst einfalle und man doch daselbst die Messe zelebrieren wolle, «damit das hochwürdige Sakrament nicht durch das BernerGebiet mit Gefahr einer Schmach getragen werden» müsse. Im Innern zu beiden Seiten des Altars die vorreformatorischen Statuen von St. Peter und Paul, die zweifellos aus der ehemaligen Mutterkirche Ferenbalm stammen. Die altgläubigen Wallenbucher sollen sie vor dem drohenden Bildersturm bei Nacht und Nebel in Sicherheit gebracht haben.
11. Bauernhaus Kapellenweg 15, 18. Jh./1822
Das stattlichste Haus des Dörfchens mit Giebelfront und Ründi -nach den Schmuckelementen das Werk eines Sensler Zimmermanns – hat zwei Lauben mit applizierten Arkaden (im Gegensatz zu den im Bernischen üblichen Ausschnitten). Renovation und Umbau 2022.
Der Hausplatz unmittelbar an der Strassenkreuzung neben der Kapelle darf wohl als Standort des Urhofes der Siedlung angesehen werden, der auf römische Zeit zurückgehen könnte (Flurname «Murmatt»!) Seit dem 17. Jahrhundert ist der Hof Eigentum des Geschlechts Hayoz gewesen, die fast durchwegs die Ammänner der kleinen Vogtei Wallenbuch gestellt haben. Gemeindepinte von 1805 bis 1855.
12. Speicher Kapellenweg 15 B, dat. 1709
Der zum Bauernhaus gehörige Speicher wurde von einem älteren Vertreter dieser Dynastie Hayoz, die auch das freiburgische Stadtbürgerrecht innehatte («Benedicht Haien»), erbaut. Zweigeschossiger Ständerbau-Speicher, hauptsächlich aus Eiche, mit umhergehender Laube und profilierten Laubenbügen. Bau- und Inschrift am Eckstud rechts neben der Treppe. Renovation 2022.
Wir wandern nordwärts durch meliorierte Felder nach Rizenbach und Vogelbuech (Gemeinde Ferenbalm).
VOGELBUECH
13. Bauernhaus Vogelbuchstrasse 7, dat. 1747
Erbaut vom Ferenbalmer Zimmermann Adam Stultz (vgl. Speicher Nr. 39A, Gurbrü, Objekt 4, Route Nord). Fachwerkbau (Rieg). Das Halbwalmdach markiert den Übergang zwischen dem älteren Vollwalm- und dem jüngeren Ründitypus, der in der Mitte des 18. Jh. auftauchte. Das Haus hat eine imposante Giebelfront mit reich verzierten, geschenkten Bügen und verrät durch die Anordnung der Fenster seine innere Einteilung: Aussen je eine grosse Stube (je zwei Fenster), in der Mitte ein schmales Stübli, dahinter eine Querküche in der ganzen Hausbreite. Das Haus wurde von Jacob Hurni aus Gurbrü gemeinsam mit seinem Schwager Adam Köchli aus Mühleberg erstellt (damals 36-bzw. 29jährig).
14. Speicher Vogelbuchstrasse 9, dat. 1764
Ständerbau-Speicher mit Ausschnitt-Lauben und originellen, individuell gestalteten Stifterbügen, darunter die einmalige Darstellung der Wappen der dreizehnörtigen Eidgenossenschaft , zum Wohnhaus umgebaut 1970.
Unter den übrigen, zum Teil stark veränderten Bauernhäusern des Weilers Vogelbuech sticht ein Heimatstilbau von 1957 hervor, wohl einer der spätesten Vertreter dieses Typs. Bemerkenswert sind ferner ein Stöckli mit Mansartdach sowie ein turmartiger zweiachsiger Stock mit ebenerdigem Keller vgl. Ferenbalm Objekt 1, Route Süd).